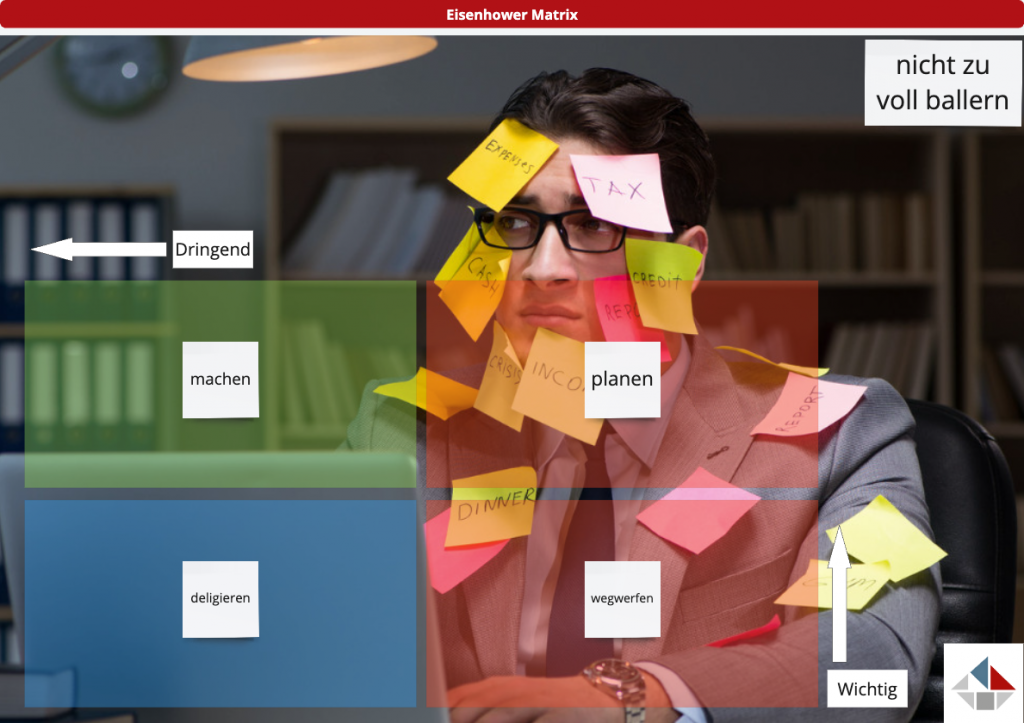Früher war ich das, was man als „echten Chaoten“ bezeichnen würde. Überall, wo ich mich aufhielt, hinterließ ich eine Spur von Unordnung. Es war fast so, als ob ich eine kleine, persönliche Naturkatastrophe wäre. Das haben mir im Laufe der Zeit auch viele Menschen unabhängig voneinander bestätigt, und das Beste daran: Ich sah es selbst kaum. Wenn ich mich in einem unordentlichen Raum befand, bemerkte ich das Chaos nicht sofort, weil ich eine hohe Toleranz gegenüber Unordnung entwickelt hatte. Diese Situation führte dazu, dass ich regelmäßig in einem Umfeld lebte, das nicht nur chaotisch, sondern auch stressig und belastend war.
Ein Schlüsselerlebnis auf meinem Weg zu mehr Ordnung war ein Gespräch mit der Mutter meiner damaligen Partnerin. Sie sagte in einem Moment der Reflexion: „Michaelus, ich bin einfach zu faul, um unordentlich zu sein!“ Dieser Satz blieb mir lange im Gedächtnis, obwohl ich ihn damals nicht wirklich verstand. „Zu faul, um unordentlich zu sein?“ Das ergab für mich keinen Sinn. Doch je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, was sie meinte. Unordnung verursacht letztlich mehr Arbeit und Zeitaufwand, weil man irgendwann alles wieder in Ordnung bringen muss. Anstatt kontinuierlich kleine Aufgaben zu erledigen, stapeln sich die Dinge, bis man vor einem Berg von Arbeit steht.
Nachdem ich eine besonders schwierige Phase durchlebt hatte – einen Burnout, der mein Leben grundlegend veränderte – wuchs in mir der Wunsch nach mehr Struktur und Ordnung. Ich erinnerte mich an den Satz der Mutter meiner Partnerin und begann, ihn in meinem Leben anzuwenden. Sie hatte recht: Ordnung zu halten ist einfacher, als die Folgen von Chaos zu beseitigen. Wenn man kontinuierlich kleine Aufgaben erledigt, spart man sich am Ende einen großen Aufwand.
Früher sah mein Umgang mit Unordnung folgendermaßen aus: Ich ignorierte das Chaos, bis es so schlimm wurde, dass es mich störte. Doch dieser Punkt war schwer zu erreichen, da ich, wie bereits erwähnt, eine hohe Toleranz gegenüber Unordnung entwickelt hatte. Wenn ich schließlich die Schwelle erreicht hatte, ging oft ein ganzer Tag oder sogar das Wochenende drauf, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Diese Aufräumaktionen waren frustrierend und machten keinen Spaß. Ich fühlte mich überwältigt von der Menge der Dinge, die ich auf einmal erledigen musste. Das führte dazu, dass ich oft schon nach kurzer Zeit die Motivation verlor und mich in einem Teufelskreis aus Unordnung und Aufräumaktionen befand.
Es musste sich etwas ändern. Also entschied ich mich, meinen Umgang mit Ordnung radikal zu verändern. Ich begann, kleine Aufgaben sofort zu erledigen, anstatt sie auf später zu verschieben. Während ich zum Beispiel darauf wartete, dass das Nudelwasser kochte, wischte ich schnell die Arbeitsflächen ab. Auf dem Weg in die Küche nahm ich das schmutzige Geschirr vom Wohnzimmer mit. Ich lernte, Dinge sofort wieder an ihren Platz zu legen, anstatt sie irgendwo liegen zu lassen. Diese kleinen Änderungen führten dazu, dass sich die Unordnung gar nicht erst ansammelte. Plötzlich war an den Putztagen kaum noch etwas zu tun, und über die Zeit hinweg hatte ich eine aufgeräumte Wohnung, in der ich mich richtig wohlfühlte.
Die Veränderung meines Umgangs mit Ordnung war ein echter Wendepunkt in meinem Leben. Es war nicht nur eine Frage der Sauberkeit, sondern auch eine Frage der mentalen Entlastung. Ordnung zu halten spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern schafft auch eine entspanntere und produktivere Umgebung. Früher fühlte ich mich oft von der Unordnung überwältigt. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, und das Chaos um mich herum trug nur dazu bei, dass ich mich gestresster und unmotivierter fühlte. Doch je mehr ich mich daran gewöhnte, kleine Aufgaben sofort zu erledigen, desto leichter wurde es, die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Eine aufgeräumte Umgebung reduziert den Stress erheblich. Es ist erstaunlich, wie sehr Unordnung das geistige Wohlbefinden beeinflussen kann. Wenn alles an seinem Platz ist, hat man das Gefühl, die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Man muss nicht mehr ständig nach Dingen suchen oder von der Unordnung abgelenkt werden. Stattdessen schafft man sich einen Raum, in dem man sich wohlfühlt und der einen unterstützt, anstatt einen zu belasten.
Diese Veränderung hat sich nicht nur auf mein Zuhause ausgewirkt, sondern auch auf andere Bereiche meines Lebens. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Art und Weise, wie man mit physischen Dingen umgeht, auf die allgemeine Lebensführung übertragen lässt. Indem ich lernte, Ordnung zu halten, entwickelte ich auch eine größere Selbstdisziplin in anderen Bereichen. Ich begann, mir Ziele zu setzen und sie konsequent zu verfolgen, anstatt Dinge auf später zu verschieben. Diese kleinen Routinen, die ich mir angeeignet hatte, schufen eine Struktur, die mir half, meine Energie besser zu nutzen und meine Zeit effizienter zu gestalten.
Das Schöne an dieser Veränderung war, dass es nicht viel Aufwand erforderte, sie in meinen Alltag zu integrieren. Es waren keine riesigen Aufräumaktionen oder dramatischen Veränderungen nötig. Stattdessen begann ich mit kleinen, einfachen Schritten. Ich nutzte die „Leerlaufzeiten“, wie das Warten auf das Nudelwasser oder die Zeit, die ich brauchte, um von einem Raum in den anderen zu gehen, um schnell ein paar Handgriffe zu erledigen. Diese kleinen Schritte führten über die Zeit zu einem aufgeräumten und stressfreien Umfeld, das mir half, mich besser zu konzentrieren und produktiver zu sein.
Ich stellte auch fest, dass diese neuen Gewohnheiten mir halfen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Früher ließ ich mich oft von der Unordnung ablenken und hatte das Gefühl, dass ich ständig Dinge aufschieben musste. Jetzt, da ich gelernt hatte, Ordnung zu halten, fiel es mir leichter, meine Aufgaben zu erledigen, ohne ständig unterbrochen zu werden. Die mentale Klarheit, die ich dadurch gewann, war ein großer Gewinn. Ich konnte mich besser fokussieren und fühlte mich insgesamt ruhiger und ausgeglichener.
Die Veränderung war nicht nur praktisch, sondern auch psychologisch eine große Erleichterung. Es fühlte sich an, als ob ich wieder die Kontrolle über mein Leben zurückgewonnen hätte. Früher hatte ich das Gefühl, dass mich die Unordnung beherrschte, doch jetzt war es umgekehrt. Ich entschied, wie meine Umgebung aussah, und ich fühlte mich viel wohler in meinem eigenen Zuhause. Diese neue Ordnung gab mir auch ein Gefühl von Stolz. Es war mein Raum, und ich sorgte dafür, dass er ein Ort war, an dem ich mich gerne aufhielt.
Diese Entwicklung führte auch dazu, dass ich insgesamt achtsamer wurde. Ich begann, bewusster zu leben und mich mehr auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, die einen großen Unterschied machen können. Indem ich lernte, Ordnung zu halten, entwickelte ich auch ein größeres Bewusstsein für meine Umgebung und die Art und Weise, wie ich mit den Dingen umging. Es war eine Lektion in Achtsamkeit, die mir half, mich besser zu organisieren und gleichzeitig mehr Freude an den einfachen Dingen des Lebens zu finden.
Natürlich war es anfangs eine Umstellung. Es brauchte Zeit und Geduld, um diese neuen Routinen in meinen Alltag zu integrieren. Doch je mehr ich mich daran gewöhnte, desto leichter fiel es mir. Es war eine positive Spirale: Je aufgeräumter meine Umgebung war, desto motivierter war ich, sie auch so zu halten. Die kleinen Handgriffe, die ich täglich erledigte, summierten sich zu einem großen Ergebnis. Und das Beste daran: Es war keine anstrengende oder stressige Veränderung, sondern eine, die mir das Leben erleichterte.
Eine weitere Erkenntnis, die ich aus dieser Veränderung gewonnen habe, ist, dass Ordnung nicht Perfektion bedeutet. Es geht nicht darum, dass immer alles makellos ist. Es geht vielmehr darum, ein Gleichgewicht zu finden, das funktioniert. Manchmal gibt es Phasen, in denen es unordentlicher ist, und das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass man die Kontrolle behält und weiß, wie man die Ordnung wiederherstellen kann. Diese Flexibilität ist entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein.
Ordnung zu halten ist eine kleine Veränderung, die eine große Wirkung haben kann. Es schafft nicht nur ein angenehmes Umfeld, sondern fördert auch das geistige Wohlbefinden und die Produktivität. Es reduziert Stress, spart Zeit und gibt einem das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Es ist erstaunlich, wie viel besser man sich fühlt, wenn die Umgebung aufgeräumt ist und man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.
Für mich war diese Veränderung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstorganisation und Resilienz. Sie hat mir gezeigt, dass es oft die kleinen Dinge sind, die den größten Unterschied machen. Indem ich lernte, kleine Aufgaben sofort zu erledigen und Ordnung zu halten, konnte ich nicht nur mein Zuhause, sondern auch mein Leben in eine positive Richtung lenken. Es war eine Lektion, die ich nie vergessen werde, und eine Veränderung, die mir bis heute hilft, mein Leben stressfreier und strukturierter zu gestalten.
Wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest und das Gefühl hast, dass Unordnung dich überwältigt, möchte ich dir Mut machen. Fang klein an. Nutze die Leerlaufzeiten, räume täglich
ein bisschen auf und schaffe dir einfache Regeln, die dir helfen, die Ordnung zu bewahren. Es mag anfangs schwer sein, aber es lohnt sich. Die kleinen Veränderungen, die du machst, werden über die Zeit zu großen Ergebnissen führen – und du wirst dich wohler und entspannter fühlen.
Es ist erstaunlich, wie viel Einfluss Ordnung auf unser Wohlbefinden und unsere Produktivität haben kann. Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß, um eine große Veränderung in Gang zu setzen. Für mich war es das Gespräch mit der Mutter meiner damaligen Partnerin, das den Stein ins Rollen brachte. Vielleicht ist dieser Text für dich dieser Anstoß. Probiere es aus – du wirst überrascht sein, wie viel besser du dich fühlst, wenn du die Kontrolle über deine Umgebung zurückgewinnst.