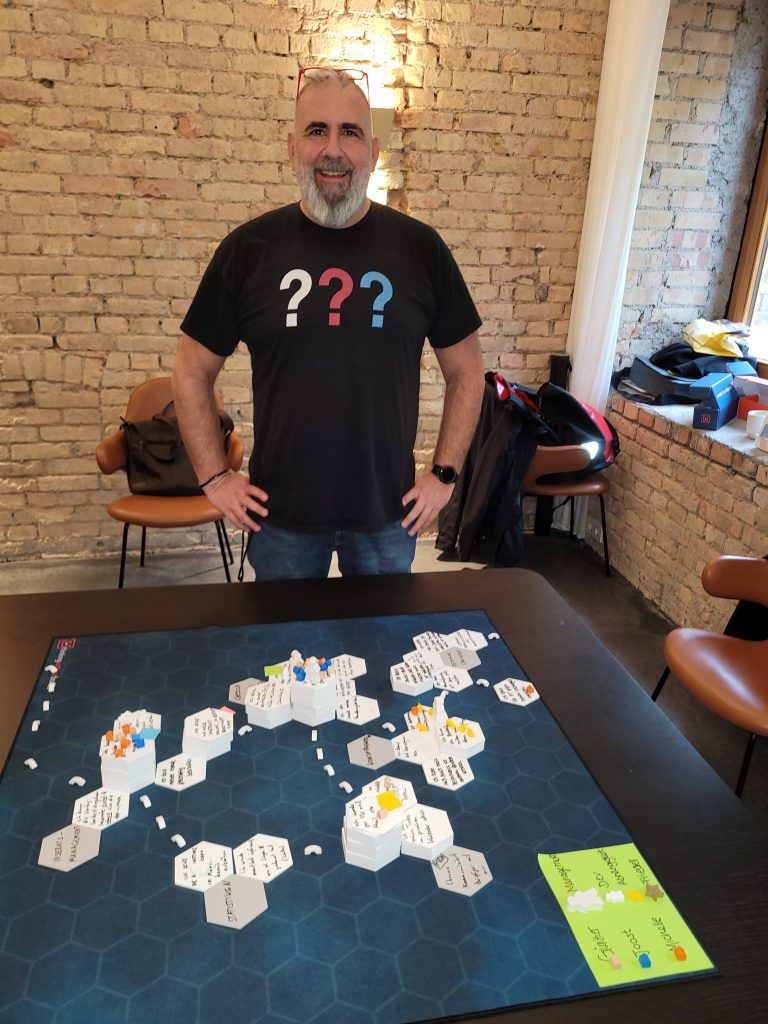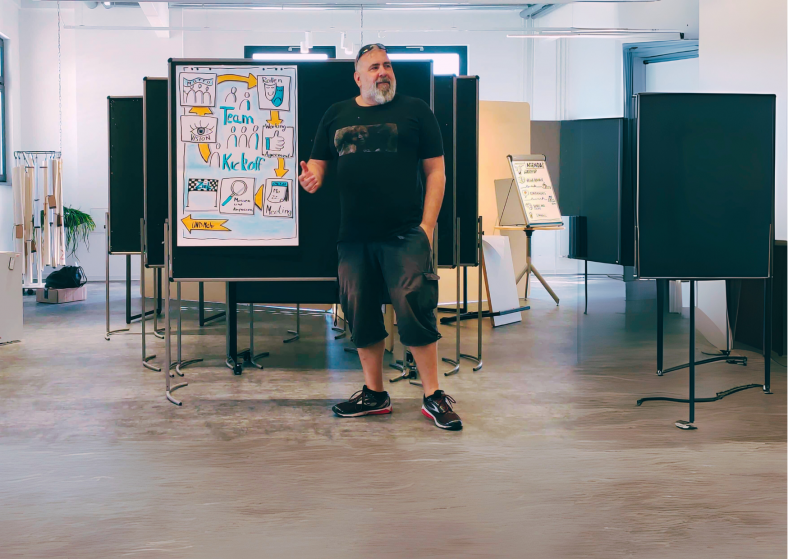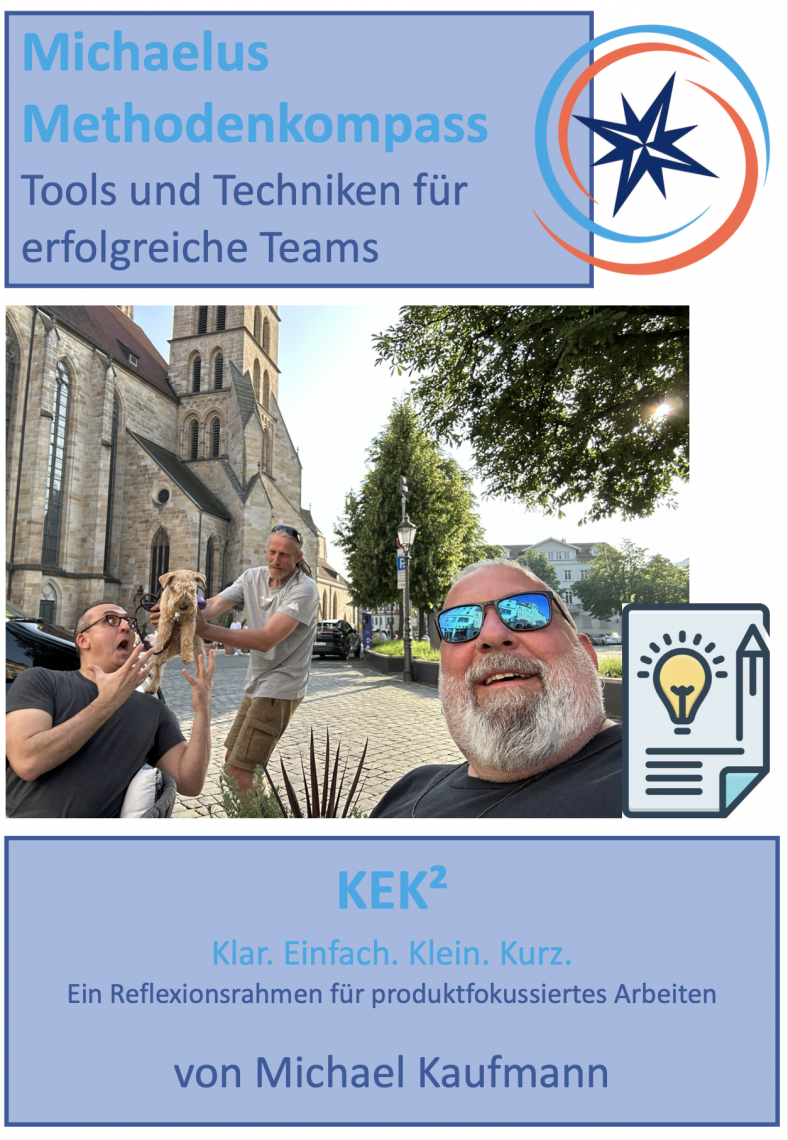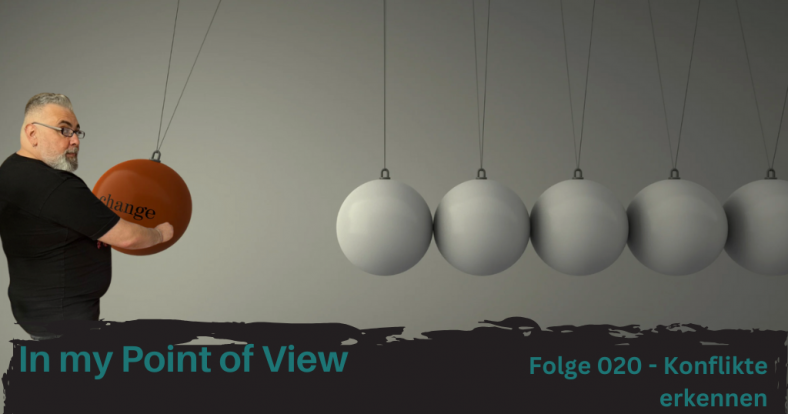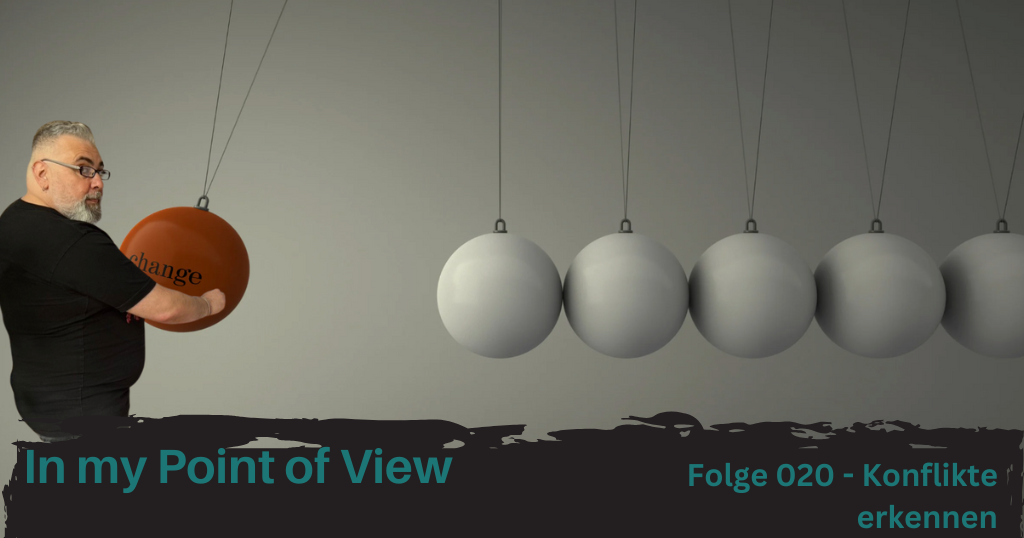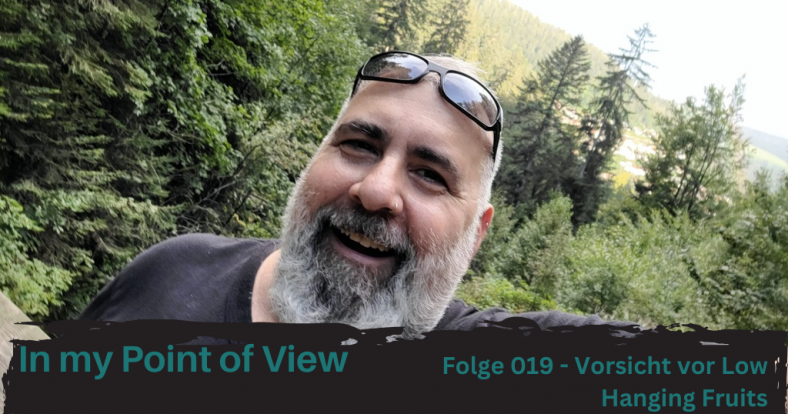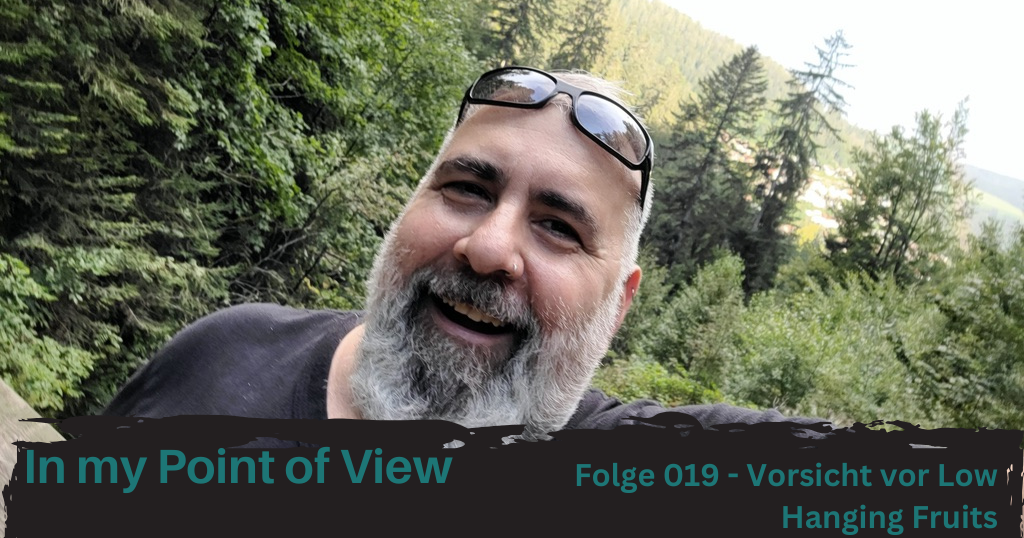Gestern bin ich über ein Video gestolpert, das mich direkt gepackt hat. Darin fiel ein Satz, der hängen geblieben ist: „Wenn du etwas an dir gefunden hast, was durch Komplimente nicht erhöht werden kann und was durch Beleidigungen nicht abgesenkt werden kann, dann ist es gut.“
Dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Er beschreibt eine innere Stabilität, die weder Lob noch Kritik aus der Bahn werfen kann. Das Bild vom weißen Blatt Papier verdeutlicht es perfekt! Es bleibt weiß, egal welche Worte darauf treffen.
Mir wurde klar, dass das nicht nur eine schöne Metapher ist, sondern etwas, das wir trainieren können – so wie einen Muskel. Also habe ich für mich (und vielleicht auch für dich) ein 7-Tage-„Weißes-Blatt“-Reflektion entwickelt. Kleine, einfache Schritte, um diese Unabhängigkeit zu stärken.
Es beginnt mit Beobachten. Wie reagiere ich, wenn jemand mich lobt oder kritisiert?
Dann folgt das bewusste Innehalten – ein tiefer Atemzug zwischen Reiz und Reaktion.
Einer meiner Lieblingsschritte im Training ist die Wolken-Metapher. Stell dir vor, deine innere Stabilität ist wie ein weiter, blauer Himmel. Lob, Kritik, Zweifel oder auch Selbstlob sind nichts weiter als Wolken, die vorbeiziehen. Manche sind leicht und hell, andere dunkel und schwer. Doch egal, wie sie aussehen – der Himmel selbst bleibt unverändert.
Wenn wir Bewertungen wie Wolken betrachten, können wir sie wahrnehmen, ohne sie festzuhalten. Sie ziehen weiter, so wie sie gekommen sind. Auf diese Weise verlieren Worte ihre Macht, und wir behalten unseren inneren Raum klar und weit.
Dann zum Schluss, die tägliche Visualisierung des weißen Blatts, an dem Worte einfach abperlen.
Das Spannende ist, nach einer Woche verändert sich der Blick. Man wird gelassener in Gesprächen, kann Lob annehmen, ohne daran zu hängen, und Kritik hören, ohne innerlich zu kippen.
Vielleicht ist das am Ende der wahre Kern von Resilienz – nicht unverwundbar zu werden, sondern sich nicht mehr unnötig verletzen zu lassen.
Führung beginnt bei dir!
#Selbstführung
#Resilienz
#InnereStärke
#Achtsamkeit
#Leadership