Müssen wir wirklich immer lauter, schneller, besser?
Reicht gut nicht mehr aus?
Ich beobachte in Teams, Organisationen und auch bei Einzelpersonen ein wiederkehrendes Muster:
Es wird gehetzt, getrieben, geschoben.
Optimiert, beschleunigt, verdichtet.
Noch ein Meeting mehr. Noch ein Tool, das uns produktiver machen soll. Noch ein KPI, der nach oben zeigen muss.
Hier das Team noch ein wenig pushen.
Dort ein bisschen mehr Fokus schaffen.
Und am Ende bitte auch die Time to Market verkürzen – aber mit Leichtigkeit, Motivation und möglichst wenig Reibung.
Ich will hier nicht falsch verstanden werden! Das alles sind wichtige Themen!
Es ist sinnvoll, gute Arbeit zu machen.
Es ist klug, Dinge zu hinterfragen.
Und es ist richtig, als Organisation effizient zu handeln. Aber…
Kann und darf es das Einzige sein, worum es geht?
Wo ist der Raum für Pause? Für Reflexion?
Für ein echtes Innehalten, das nicht gleich als Zeitverschwendung gilt?
Wann feiern wir, was schon da ist – ohne gleich im nächsten Atemzug zu fragen, wie es noch besser gehen könnte? Und ohne in eine Wellnesoase abzudriften in der das Ausruhen nur noch Selbstzweck ist!
Denn so wie unser Körper nicht im Dauerlauf funktionieren kann, braucht auch ein Team Phasen der Regeneration. Nicht jede Anstrengung lässt sich linear skalieren. Nicht jede Initiative braucht sofort eine Wirkungsmessung.
Und das ist nicht nur eine Frage der Haltung – sondern auch eine psychologisch hochrelevante Beobachtung.
Die Forscher Thomas Curran und Andrew P. Hill haben in einer umfassenden Meta-Studie (Perfectionism Is Increasing Over Time, Psychological Bulletin, 2017) den besorgniserregenden Anstieg von Perfektionismus unter jungen Erwachsenen untersucht.
Ein zentrales Ergebnis war der gesellschaftliche und berufliche Druck, immer mehr leisten und sich immer weiter verbessern zu müssen, führt bei vielen zu einem Phänomen, das sie als socially prescribed perfectionism bezeichnen – also der tief verankerten Überzeugung, nur dann akzeptiert zu sein, wenn man den (vermeintlichen) Erwartungen anderer entspricht.
Dieses Muster hat gravierende Folgen. Erhöhte Burnout-Raten, depressive Symptome, innere Leere. Das Gefühl, nie genug zu sein – egal, was man erreicht.
In Organisationen äußert sich das oft in chronisch überforderten Teams, Innovationsmüdigkeit und einer Kultur, in der Fehler nicht mehr als Lernchancen, sondern als Schwächen gewertet werden.
Der Output steigt kurzfristig, die Widerstandskraft sinkt langfristig.
Was also tun?
Vielleicht beginnt es mit einer ganz einfachen, fast zärtlichen Frage:
Reicht das, was wir gerade tun – so wie wir es tun – vielleicht einfach aus?
Nicht alles muss wachsen.
Nicht alles muss schneller gehen.
Nicht alles muss messbar besser sein.
In der Medizin nennt man ständiges, unkontrolliertes Wachstum Tumor. Nur mal so als Denkangebot…

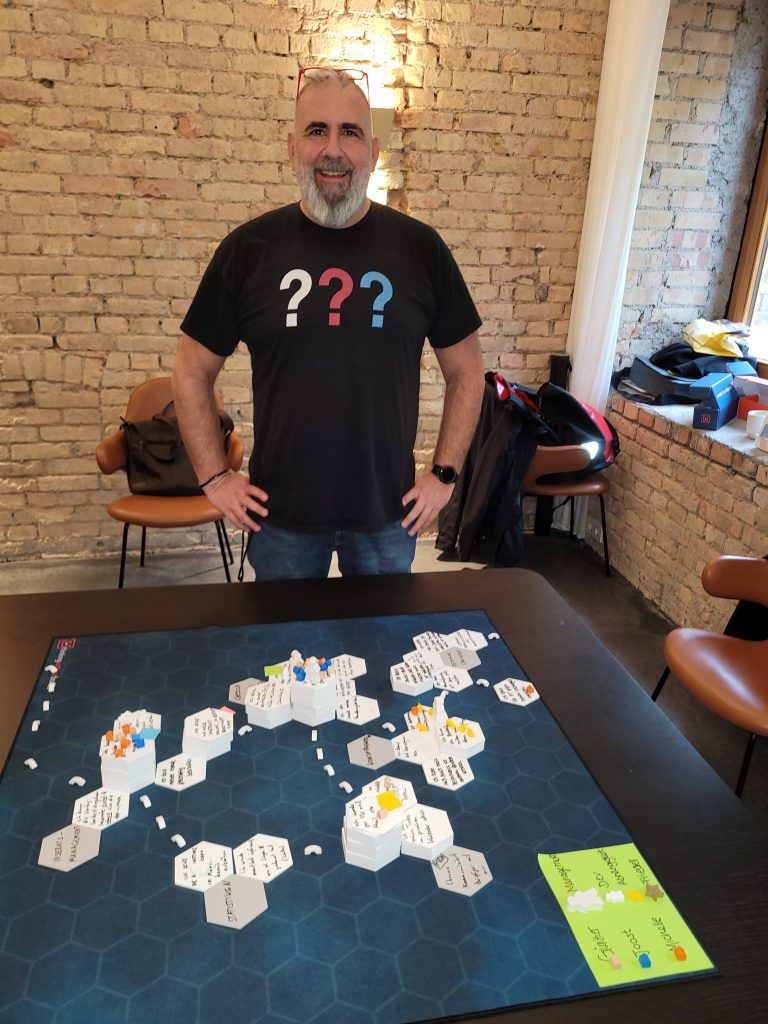
Schreibe einen Kommentar